HALO-Forschungsflugzeug untersucht Wolken von Neuseeland aus
Saubere Atmosphäre der Region um die Antarktis im Fokus
Gemeinsame Pressemeldung der an HALO-South beteiligten Institute mit Ergänzungen des MPI für Chemie
Oberpfaffenhofen/Leipzig/Mainz. Das deutsche Forschungsflugzeug HALO wird aktuell an seiner Heimatbasis beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen für den Einsatz in Neuseeland vorbereitet: Während der Mission „HALO-South“ wollen die Forschenden ab September unter Leitung des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) das Zusammenspiel von Wolken, Aerosolen und Strahlung über dem Südlichen Ozean untersuchen. Dazu wird HALO fünf Wochen lang von Christchurch aus Messflüge über den Ozeanen in der sauberen Südhemisphäre unternehmen. Seit der Inbetriebnahme 2012 war HALO bisher nur ein einziges Mal so weit im Süden im Einsatz. Die Mission in Neuseeland ist daher eine Premiere: Nie zuvor hat ein deutsches Forschungsflugzeug den Südpazifik und das angrenzende Südpolarmeer in dieser Region untersucht. Die Flugzeugmessungen während „HALO-South“ werden hauptsächlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert mit Beteiligungen vom Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sie sind der Auftakt zu intensiven Forschungskooperationen zwischen Deutschland und Neuseeland.

Von den Messungen erhoffen sich die Forschenden nicht nur wichtige Daten, um Wettervorhersagen und Klimamodelle im wenig erforschten Süden optimieren zu können, sondern auch ein besseres Grundlagenverständnis wie die Atmosphäre und die Wolken auf einen Rückgang der Emissionen in den kommenden Jahrzehnten reagieren werden. Der Blick in die sauberere Atmosphäre rund um die Antarktis ist daher für das Team, zu dem auch Forschende des Max-Planck-Instituts für Chemie gehören, ein Blick in die Zukunft.
Warum neuseeländische Wolken anders sind
Der Südliche Ozean rund um die Antarktis ist eine der wolkenreichsten Regionen der Erde. Aktuelle Klimamodelle basieren vorallem auf Messungen in der Nordhemisphäre. Da die Südhemisphäre weniger Landmasse, weniger Bevölkerung und weniger Industrie aufweist, ist sie deutlich sauberer als die Nordhemisphäre. Weil die Atmosphäre im Süden sauberer ist, gibt es weniger Partikel, an denen sich Tröpfchen oder Eiskristalle bilden können. Deshalb gibt es dort in den Wolken weniger Eis und mehr flüssige Wassertropfen als im Norden. Atmosphärische Modelle arbeiten aber bisher vorwiegend mit Daten aus der Nordhemisphäre, was zu Unsicherheiten in der Südhemisphäre führt. Diese Diskrepanz ist seit einigen Jahren bekannt, aber es fehlt an Messungen im Süden, um die Klimamodelle entsprechend anpassen zu können.

„Wir hoffen, dass wir mit der groß angelegten Messkampagne HALO-South einen wichtigen Beitrag liefern können, um diese Lücke zu schließen“, erklärt Kampagnenleiterin Prof. Mira Pöhlker vom TROPOS und der Universität Leipzig. Dazu kommen auf HALO 22 spezielle Messgeräte von acht Instituten zum Einsatz, um den kompletten Zyklus der Wolkenbildung von der Partikelbildung aus Vorläufergasen über die Wolkenkeime bis hin zu den Strahlungseigenschaften der Wolken untersuchen zu können. „Wir sind sehr froh, dass wir sehr viele erfahrene Expertinnen und Experten an Bord haben, um zusammen Fragen zu klären wie: Welche Aerosole gibt es im Südlichen Ozean? Woher kommen sie? Wie verändern sie die Wolken?“
Für die Mission „HALO-South“ sind 176 Flugstunden geplant. Vor Ort werden rund 50 Forschende sein: vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS), dem Leipziger Institut für Meteorologie der Universität Leipzig, der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), der Goethe-Universität Frankfurt (GUF), dem Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) Mainz, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), dem Institut für Physik der Atmosphäre des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Forschungszentrum Jülich (FZJ). Der Betrieb des Flugzeugs wird durch die Einrichtung Flugexperimente (FX) des DLR Oberpfaffenhofen realisiert. Mit Messungen am Boden beteiligen sich außerdem die University of Canterbury, Christchurch, und der MetService New Zealand.
MPI für Chemie Messgeräte mit an Bord

Zu den Messgeräten zählen auch das Aerosol-Massenspektrometer C-ToF-AMS (Compact Time-of-Flight Aerosol Mass Spectrometer) und das ALABAMA-System (Aircraft-based Laser Ablation Aerosol Mass Spectrometer) des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie. Beide Instrumente sind zentral für die Analyse der chemischen Zusammensetzung von Aerosolpartikeln – sowohl im Gesamtluftvolumen als auch auf Ebene einzelner Partikel. Weitere Instrumente aus den Abteilungen Aerosol- und Multiphasenchemie des MPIC sind ein Sensor zur Messung von Rußpartikeln (SP2), ein Wolkenkondensationskeimzähler (CCNC) sowie das FASD-System (Fast Aerosol Size Distribution), das in Kooperation mit dem TROPOS betrieben wird und zur schnellen Bestimmung der Partikelgrößen von Aerosolen dient.
„HALO-South wird einzigartige Einblicke in das Zusammenspiel von Aerosolen und Wolken auf der Südhalbkugel liefern – von der Bildung von Wolkentröpfchen und Eiskristallen bis hin zur Entstehung von wolken- und eisaktiven Partikeln, die teils durch erhöhte Strahlung über den Wolken und deren optische Eigenschaften beeinflusst werden“, erklärt Dr. Johannes Schneider, Leiter der Forschungsgruppe „Aerosol-Feldexperimente“ in der Abteilung Aerosolchemie am Max-Planck-Institut für Chemie.
HALO-South: Beginn einer Kooperationsreihe in der Atmosphärenforschung
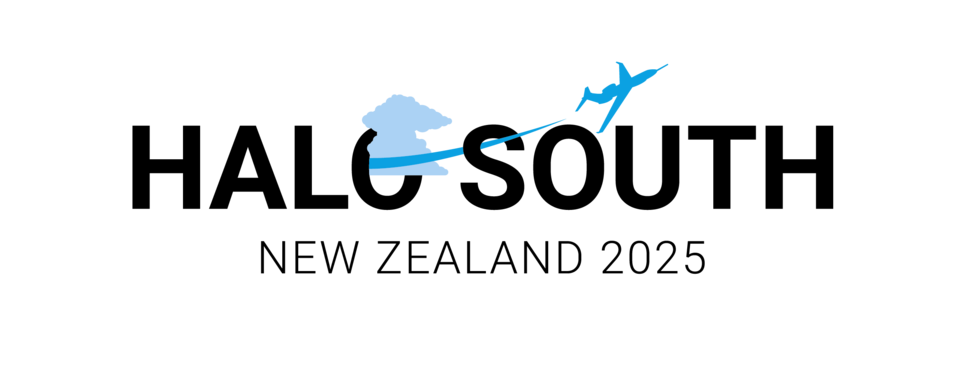
Im September endet in der Region der Winter und der Frühling beginnt. Diese Jahreszeit wurde ausgewählt um eine besonders saubere Atmosphäre über den Meeren rund um Neuseeland untersuchen zu können. Die Kampagne wird eingebettet sein in parallele intensive Feldaktivitäten wie bodengestützte Messungen von Neuseeland aus und wird durch Satellitenuntersuchungen unterstützt werden. So wird zum Beispiel der Flugplan vor Ort an die Überflüge des ESA-Erdbeobachtungssatelliten EarthCARE angepasst, um genau unter dem Satellitenorbit zu fliegen. Die Mission „HALO-South“ unterstützt damit sowohl die Validierung des ESA-Satelliten als auch das EU-Projekt CleanCloud, das Wechselwirkungen zwischen Aerosolen und Wolken untersucht, um unser Verständnis der Klimadynamik in einer sich ständig verändernden Welt zu verbessern. Prof. Andreas Macke, Direktor des TROPOS, der „HALO-South“ 2018 initiiert hatte, ergänzt: "Ich freue mich, dass wir mit diesem und weiteren Projekten im Konzert mit internationalen Partnern die Erforschung der Südhemisphäre auf ein nie da gewesenes Niveau heben können."
Ergänzt werden die Flugzeugmessungen von HALO außerdem durch Bodenmessungen auf dem Gelände des MetService New Zealand in Invercargill im äußersten Süden Neuseelands. Von September 2025 bis März 2027 werden dort während der Messkampagne „goSouth-2“ mehrere Fernerkundungs- und in-situ-Messgeräte von TROPOS die Wolkeneigenschaften analysieren, um eine detaillierte Kontraststudie zwischen sauberer antarktischer Luft und aerosolbelasteter australischer Luft zu erstellen. Während HALO-South werden neben den auf rund zwei Jahre angelegten Messungen in Invercargill auch am Tāwhaki National Aerospace Centre auf der östlichen Seite der Südinsel von Neuseeland begleitende Bodenmessungen der Universitäten Leipzig und Canterbury durchgeführt. Dort werden insbesondere ein Wolkenradar und ein Doppler-Wind-Lidar zur Erfassung der für die „HALO-South“-Kampagne wichtigen Wolkenstruktur beitragen. Die Mission HALO-South bildet somit den Auftakt zu einer Reihe intensiver Kooperationen im Bereich der Atmosphärenforschung zwischen Deutschland und Neuseeland. Die Untersuchungen rund um die Antarktis sollen 2027-2030 im Rahmen des großen internationalen Forschungsprojektes „Antarctica InSync“ mit einer Reihe von Antarktis-Expeditionen fortgesetzt werden, für die aktuell die Planung läuft und bei der Atmosphärenforschung ebenfalls eine Rolle spielen wird.
Der Südliche Ozean: Ein natürliches Labor für Wolken- und Aerosolforschung
„HALO-South“ wird dringend benötigte Erkenntnisse über die Beziehung zwischen Aerosolen und Wolken auf der Südhalbkugel liefern, von der Bildung von Wolkentröpfchen und Eis bis hin zur Veränderung des Strahlungsbudgets durch die Wolken, welche wiederum für die Entstehung von Aerosolen relevant sind. Diese Erkenntnisse werden anhand von Satellitendaten und globalen Klimamodellen auf einen größeren Maßstab hochgerechnet. Die Kampagne wird auf früheren HALO-Kampagnen aufbauen und diese fortsetzen, deren Schwerpunkt entweder auf Wolken- und Aerosoleigenschaften oder auf Gas- und Aerosoleigenschaften lag (ML-CIRRUS, CIRRUS-HL, ACRIDICON, CAFE-EU, CAFE-Brasil, CAFE-Pacific, EMeRGe-EU und EMeRGe-Asia). Die Messungen bei HALO-South sollen die Wechselwirkung mit Aerosolen im gesamten Lebenszyklus der Wolken von der Bildung bis zur Auflösung erfassen. Mit der aufwendigen Messkampagne wollen die Forschenden die Unterschiede zwischen südlicher und nördlicher Hemisphäre besser verstehen, um Wettervorhersage und die Klimamodelle zu verbessern. Sie erhoffen sich zudem ein besseres Verständnis darüber, wie sich die Atmosphäre der Nordhemisphäre in einer zunehmend dekarbonisierten Welt ohne Industrieabgase verändern wird.
HALO
Das Forschungsflugzeug HALO ist eine Gemeinschaftsinitiative deutscher Umwelt- und Klimaforschungseinrichtungen. HALO wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), des Freistaats Bayern, des Forschungszentrums Jülich (FZJ), des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) beschafft.
Der Betrieb von HALO wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), dem Forschungszentrum Jülich (FZJ), dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig (TROPOS) getragen. Das DLR ist zugleich Eigner und Betreiber des Flugzeugs.
Hinweis für die Medien:
HALO wird bis 29.8. beim DLR in Oberpfaffenhofen auf den Einsatz in Neuseeland vorbereit. Bei Interesse an Foto-/Video-Aufnahmen vor Ort wenden Sie sich bitte an Bernadette Jung, DLR-Pressestelle, Tel: +49 8153 28-2251, bernadette.jung@dlr.de.
In der ersten September-Woche erfolgt die Überführung von HALO nach Neuseeland. Erste Messflüge von „HALO-South“ sind für die zweite September-Woche geplant, letzte für die zweite Oktoberwoche. Zurück erwartet wird HALO in Oberpfaffenhofen am 17. Oktober 09:00 MEZ.
Links:
Mission „HALO-South“
https://halo-research.de/sience/future-missions/halo-south/
Messkampagne „goSouth-2“
https://www.tropos.de/aktuelles/science-blog/beitrag/gosouth-2
EU-Projekt „Clouds and climate transitioning to post-fossil aerosol regime“ (CleanCloud)
https://projects.au.dk/cleancloud
ESA-EarthCARE
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/EarthCARE
https://earth.esa.int/eogateway/missions/earthcare



